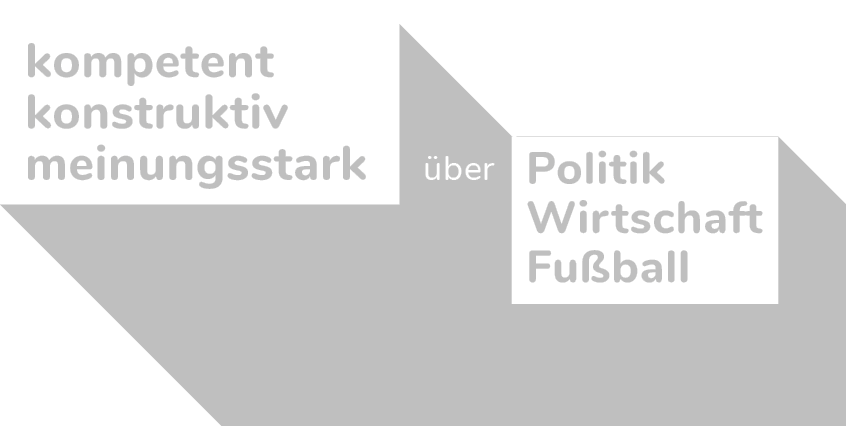„Ja, sie war schön. Dunkel und blass, voller Anmut und Mut. Mit vierzehn liebte sie einen Studenten, der sich nicht für sie interessiert, und wird von einem siebzehnjährigen Schulkameraden vergöttert, den sie schließlich, als sie zwanzig ist, doch heiratet. Flitterwochen in Paris, aber schon längst ist klar: Eine bürgerliche Ehe wird das nicht. Der Bräutigam schreibt Gedichte und macht sich bald auf zu einer seiner exotischen Reisen nach Afrika. Sie bleibt an der Seine und lernt den noch völlig unbekannten Amadeo Modigliani kennen, der sie malt und malt und malt. Er schenkt ihr einen Stoß von Zeichnungen; eine davon wird sie in all ihren wechselnden Wohnungen, Zimmern bis an ihr Lebensende retten, wie eine Ikone. Die anderen sind nach und nach verschollen (erst 1992 tauchten bei einem Freund Modiglianis noch weitere zehn Zeichnungen aus jenen Tagen auf). Schon als Mädchen hat sie geschrieben. Und nun zitiert sie Verse von Verlaine, Baudelaire, Mallarmè, als atme sie Poesie. Ihr Gatte, der zunächst skeptisch ist, sieht, wie sie sich entwickelt, und führt sie ein in das literarische Leben von St. Petersburg. Sie ist dreiundzwanzig, als sie einen Sohn zur Welt bringt, sich von ihrem Mann trennt und im Selbstverlag ihren ersten Gedichtband veröffentlicht.
„Mir war kalt, und ich glaubte zu sinken,/ aber leicht war mein Schritt und gewandt./ Und ich streifte den Handschuh der Linken/ verwirtt auf die rechte Hand.“
Sie wird Dichterin des genauen Gefühls und der sprechenden Geste. Ihr Ton ist alltagsnah, musikalisch und kann sofort verstanden werden. Der zweite Lyrikband ist ein großer Erfolg, spätestens mit dem dritten (sie ist keine dreißig) ist ihre Stimme eine Institution. Dann ändert die Oktoberrevolution alles. Ihre Gedichte werden zwanzig Jahre lang nicht gedruckt, ihre Bücher vernichtet. Als auswendig gelerntes Schmugglergut leben sie weiter. Als 1940 wieder ein Band von ihr erscheint, kommt es in den Buchhandlungen zu Prügeleien.
Vermutlich um sie einzuschüchtern, lässt man ihren einzigen Sohn immer wieder verhaften; insgesamt verbringt er fünfzehn Jahre seines jungen Lebens in Gefängnissen und Lagern, und sie steht Tage, Wochen – „siebzehn Monate“ schreibt sie – immer wieder in Warteschlangen, um Nachricht von ihm zu erhalten. Sollte ihr einmal ein Denkmal errichtet werden, hat sie sich in einem ihrer Gedichte gewünscht, dann sollte es nicht in einem Park stehen, sondern in dem Gefängnishof, in dem sie gewartet hat. Es solle den schwarzen LKW sehen, der die Häftlinge abholt. Auch das Denkmal soll Zeuge des Leids der Angehörigen werden. Als junge Frau schrieb sie:
„Wofür ich sang, wovon ich träumte,/ Es hat mir nur das Herz zerrissen.“
Mit 56 Jahren hat sie noch einmal die Liebe zu einem um zwanzig Jahre jüngeren Philosophen und Historiker gelebt und aufgeschrieben.“