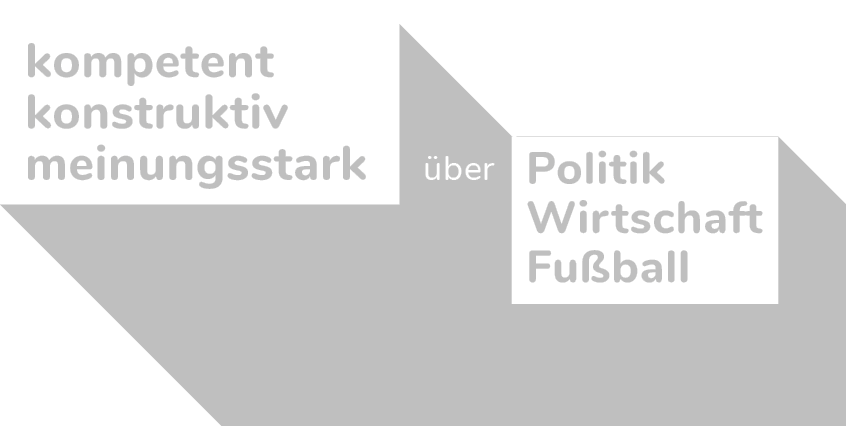Von Ronald Reng
Eines Tages erhielt ich eine E-Mail von Athletic Bilbao und lernte, was ein professioneller Fußballverein alles macht. Man würde mich gerne einladen, schrieb mir ein Vereinsangestellter: zu Athletics Literaturfestival.
Unter Kulturveranstaltern hatte ich Fußballklubs bis dahin eher nicht vermutet. Enthusiastisch und FAZ-Lesenswert neugierig reiste ich zum Festival „Ball und Buchstabe“. Zwei Tage lang kam ich in Bilbao aus dem Staunen nicht heraus.
Zum Mittagessen empfing mich Ernesto Valverde, der damals sehr erfolgreich Athletic trainierte und heute
die Mannschaft des FC Barcelona anleitet. Valverde hatte mein Buch über den verstorbenen deutschen
Nationaltorwart Robert Enke gelesen und wollte sich gerne mit mir darüber unterhalten. Der Trainer stellte mir Fragen zum Inhalt, er redete über Stil und Ton des Buchs, und ließ, so nebenbei, fast schüchtern, fallen, dass er gerade nicht nur die Taktik für ein Europapokalspiel gegen den FC Augsburg vorbereitet hatte, sondern auch ein Literaturgespräch mit 14 Strafgefangenen. Ich muss irgendwie dämlich
geschaut haben. Ja, doch, erklärte mir Gelder Reguera, der Organisator von Athletics Kultur-Aktivitäten, der Trainer übernehme bei ihnen auch solche Aufgaben.
Als Thema für den Lesezirkel im Gefängnis von Bilbao hatte Valverde die Autobiographie von Edward Bunker ausgesucht. Das Buch sollte passen. Bunker, ein amerikanischer Schriftsteller, verbrachte fast zwei
Jahrzehnte im Gefängnis, wegen Banküberfällen, Drogenhandels und anderer Kleinigkeiten.
Ein Verein, der Literaturtage (und ein Filmfestival) veranstaltet, der seinen Trainer zu Lesedebatten in
Gefängnisse und Schulen schickt; es war nicht mehr zu übersehen: Athletic, das seit über 100 Jahren wider
den Trend zur Globalisierung nur baskische Fußballer einsetzt, geht es darum, anders zu sein. Doch seit
meinem Besuch in Bilbao habe ich mich oft gefragt, warum nicht alle Profivereine versuchen, wie Athletic
zu sein: Warum sie nicht viel stärker versuchen, sich über das Meisterschaftsspiel am Samstag hinaus als
Institution in ihrer Stadt oder Region zu verankern.
Zum einen aus Eigeninteresse, weil ein gesellschaftliches Engagement die Bindung des
Publikums zu seinem Klub stärkt, zum anderen weil Fußball ein wunderbarer Anknüpfungspunkt ist, viele
Menschen zu erreichen. In meinen Jahren als Fußballreporter habe ich durchaus einige tolle Beispiele erlebt; allein, es blieben Einzelfälle. So war ich im Stadion The Den des FC Millwall, als dort keine Tore fielen, sondern Nachhilfelehrer mit Kindern aus dem harten Londoner Osten Hausaufgaben machten. Der Klub bezahlte die Lehrkräfte. „Wenn die Kinder erzählen können: Ich gehe zu Millwall, gefällt ihnen das. Es ist anders, als zu sagen: Ich gehe in die Schule“, sagte mir Jim Hicks, der Leiter von Millwalls Projekt.
Heute, 20 Jahre nachdem der FC Millwall als erster Fußballklub weltweit ein „Football in the Community“-Programm startete, sehe ich erstmals die Chance, dass der Profifußball als Ganzes, als
System, seine ungeheure Kraft für gesellschaftliche Verbesserungen nutzt. Der spanische Weltmeister
Juan Mata hat das Projekt „Common Goal“ gestartet: Ein Prozent seines Gehalts fließt fortan an
Organisationen, die den Fußball als Mittel für soziale Aufgaben einsetzen. In wenigen Wochen haben sich
bekannte Fußballer wie Mats Hummels, Serge Gnabry oder der Hoffenheimer Trainer Julian Nagelsmann
Matas Initiative angeschlossen. Die öffentliche Aufmerksamkeit und Sogwirkung, die „Common Goal“
erzeugt, kann dazu führen, dass sich solches Engagement wie von Athletic oder Juan Mata
irgendwann – bald – nicht mehr vereinzelt und letztendlich zufällig, sondern systematisch vollzieht.
Dass also der gesamte Profifußball, von der FIFA über die Vereine bis zu den Spielern, es als Teil seines
Daseins sieht, sich für gesellschaftliche Zwecke einzusetzen. Solch ein Engagement hat zuvorderst nichts mit dem dumpfen Neidgeschrei zu tun, Fußballer verdienten zu viel und müssten deshalb etwas
abgeben. Ich bin absolut dafür, dass der Löwenanteil des vielen Geldes im modernen Profispiel, an jene geht, die es generieren: die Spieler und Trainer. Aber der Spitzenfußball erreicht heute Menschen aller Art leichter als jede andere soziale Bewegung, da liegt es auf der Hand, die Begeisterung für das Spiel als
gesellschaftliche Triebkraft zu nutzen.
Das Unternehmen namens „streetfootballworld“ das hinter „Common Goal“ steckt, scheint mir bei allem, was ich über es recherchieren konnte, professionell und kreativ genug, um die Initiative zu einem Erfolg zu führen: Gegründet von dem Deutschen Jürgen Griesbeck hat „streetfootballworld“ mittlerweile über 100
lokale Fußball-Initiativen weltweit vernetzt, es überprüft diese Projekte regelmäßig und beschafft ihnen, wenn nötig, Anschubgelder, strebt aber, wo möglich, ihre Eigenfinanzierung an. Wie eine Consultingfirma berät „streetfootballworld“ Unternehmen a la Sony oder FedEx, in welches Fußball-Sozialprojekt sie investieren können – und finanziert sich mit den anfallenden Beratungshonoraren nicht nur selbst, sondern steckt einen Teil davon wiederum in Projekte. Diese reichen von Initiativen wie Gol y Paz in Kolumbien, bei der ehemalige Bürgerkriegsfeinde gemeinsam Fußball spielen und darüber ins Gespräch kommen, bis zur klassischen Lernmotivation benachteiligter Kinder mit dem Lockmittel Fußball, so wie ich sie damals beim FC Millwall erlebte.
In der Schulbücherei der Tower Bridge Primary School saß damals einer von Millwalls Sozialarbeitern Marc Micalief mit einem halben Dutzend Zehnjähriger um den Tisch und ließ sie die Fußballberichte aus den Tageszeitungen vorlesen. Micalief erklärte ihnen, dass sie demnächst selber zu einem Spiel von Millwall gehen, in der Pressekonferenz den Trainern Fragen stellen und einen Bericht schreiben würden. Ein Junge sagte: „Da ziehe ich einen Anzug an, alle Reporter haben Anzüge an.“ Die Kinder, die sich im normalen Unterricht oft nur schwer motivieren ließen, waren an diesem Tag nach Schulschluss freiwillig da geblieben.
Fußball bringt Kinder zum Lernen. Deshalb hoffe ich vehement, dass das System Fußball „Common Goal“ nicht als ein vermeintliches Feigenblatt abtut, sondern als wunderbare Chance begreift. Nicht nur Fußballer selbst sollten sich engagieren, sondern zum Beispiel auch die Fußballmedien. So wie die Spieler 1 Prozent ihres Gehalts geben, so könnten die Sportteile der deutschen Tageszeitungen 1 Prozent ihrer Seiten im Jahr für die Berichterstattung über Fußball als soziale Kraft frei machen.
Solch ein Engagement, da bin ich sicher, bringt auch denen, die geben, einen enormen Gewinn. Es wird Fußballern wie Juan Mata oder Mats Hummels noch mehr Freude am eigenen Leben, mehr Zufriedenheit mit sich selbst schenken.
Beim Mittagessen in Bilbao erschien mir Ernesto Valverde auch deshalb ein so fähiger Fußballtrainer, weil er über einen offenen Blick für das Leben, das ganze Leben, verfügt. Irgendwann in unserem Gespräch über Bücher sprach er auch über ein Werk namens „Halbzeit“, einen Fotoband mit 66 Schwarz-
Weiß-Bildern, einige davon in der Welt des Profifußballs aufgenommen, andere in einem Schlachthof oder auf den Straßen Südamerikas.
Ernesto Valverde beschrieb mir das Buch ein wenig, aber er lobte den Autor von „Halbzeit“
nicht. Das gehörte sich nicht, fand er wohl, aus Höflichkeit. Denn der Autor jenes Fotobuchs ist: Ernesto Valverde.