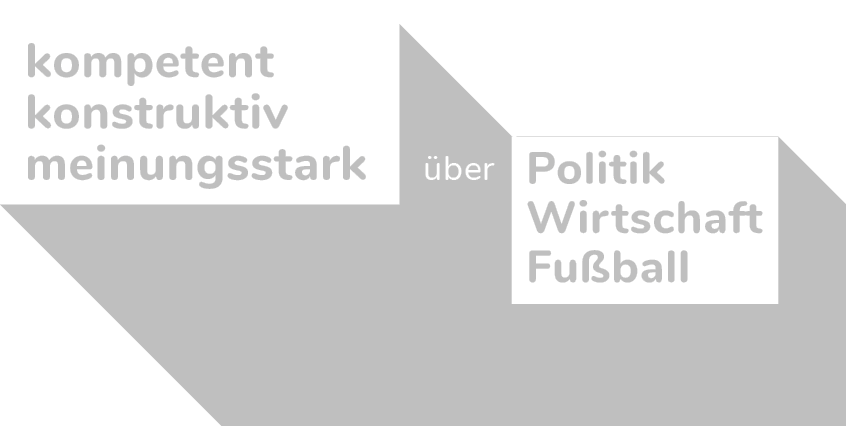Jetzt entdeckt der Ort seine Vergangenheit: Dieses Licht! Sanft und doch strahlend, so frisch und klar, man meint es riechen zu können. Jetzt dort hinten mit dem Pferd über die grasbewachsene Ebene galoppieren, auf das Gebirge zu, auf die schneebedeckten Gipfel des Kleinen Kaukasus. Schwer zu begreifen: Diese Weiten, sattgrün im Frühling, sonnenverbrannt im Herbst, das war ihre Heimat. Die der Auswanderer aus Württemberg, aus Reutlingen, Betzingen, Altbach, insgesamt 140 Familien, die vor zwei Jahrhunderten dieses Dorf hier gegründet haben, nach einer gefahrvollen und verlustreichen Reise von anderthalb Jahren: Helenendorf.
Sie hatten einem Land den Rücken gekehrt, das unerträglich geworden war. Württemberg war ausgeblutet durch zwei Jahrzehnte napoleonische Kriege, regiert von einem König, dem die hungernden Bauern erklärtermaßen wurscht waren und der das Land auspresste, um in Stuttgart und Ludwigsburg seinen prächtigen Hofstaat zu unterhalten. Dazu kam eine fürcherliche Serie von Missernten – mit dem Höhepunkt 1816, dem „Jahr ohne Sommer“. Die Obstbäume fruchteten nicht, das Getreide verfaulte auf den Feldern; der Zehnt aus der Weinernte, der an die Oberfinanzkammer gemeldet wurde, fiel von 16.842 Eimern im Jahr 1811 auf 654 Eimer 1816. Für viele war der Glaube die einzige Zuflucht; der Pietismus und die Hoffnung auf eine baldige Wiederkehr Christi entwickelten sich zu einflussreichen Strömungen.
Da kam das Angebot des russischen Zaren Alexander l. (der ein halber Schwabe war, denn seine Mutter war Württembergerin) wie gerufen: Er bot Auswanderwilligen eine neue Heimat im Kaukasus, mit Religionsfreiheit und ohne Militärpflicht. Wer dabei sein wollte, musste allerdings Handwerker oder Weinbauer sein und ein beträchtliches Barvermögen von 300 Gulden vorweisen. Es war klassischer Mittelstand, der da sein Land verließ.
So entstand dieses deutsche Dorf, weitab im Orient. „Romantisch und lieblich am Nordabhang des Kleinen Kaukasus gelegen“, so ein Reisebericht von 1910, „erblüht im fernen Asien zwischen wilden Völkern ein deutsches Gemeinwesen.“ Der Autor lobt die „Arbeitsamkeit und Redlichkeit“ der Siedler, die sich „eine feste Anhänglichkeit an das Heimatland ihrer Voreltern bewahrt“ hätten.
Nach extrem schwieriger Anfangszeit war Helenendorf zu einer prächtigen Gemeinde herangewachsen. Die Wagenbaufirma Votteler verkaufte weithin ihre vierrädrigen Pferdewagen; die Vohrers und die Hummels verkauften ihren Wein; es gab Kirche und Schule, Sinfonie- und Blasorchester, alle denkbaren Handwerke und die erfolgreiche Winzergenossenschaft Konkordia, die in vielen Städten Niederlassungen unterhielt.
Wie fern das alles ist! Das Land heißt heute Aserbaidschan und Helenendorf heißt Göygöl. Bei einem Besuch der Botschafterin der Bundesrepublik wird ihr Margarete Reitenbach vorgestellt, eine alte Dame, klein, aufrecht, zäh, die 1933 in Helenendorf geboren wurde und die ihre Geschichte erzählt: 1937 wurde der Vater als angeblicher Spion verhaftet und erschossen, 1941 wurde das achtjährige Mädchen mit ihrer Familie wie alle Deutschen in die kasachische Steppe deportiert, wo es in den ersten Monaten um das nackte Überleben ging; jahrzehntelang lebte Margarete Reitenbach dann im sowjetischen Kasachstan, bis sie Anfang der Neunziger nach Deutschland übersiedeln durfte.
Jeder hat solche Geschichten von Vater, Onkel, Großvater, deportiert, verhaftet, erschossen; oft existieren nicht einmal Unterlagen über die genauen Todesumstände, geschweige denn, dass man einen Ort zum Trauern hätte.
Wenn Margarete Reitenbach von früher erzählt, rutscht sie noch stärker ins Schwäbische hinein als ohnehin schon. Darauf angesprochen, erzählt sie von ihrem Enkel, der in der Schule gefragt wurde, wie viele Sprachen er spreche. „Drei“, war die Antwort, „Deutsch, Russisch und Wogehtschtna.“ – „Was ist das?“ – „So spricht d´Oma.“ Die wahre Heimat ist manchmal eben doch die Sprache. (Martin Rasper schrieb diesen Artikel für die FAZ)