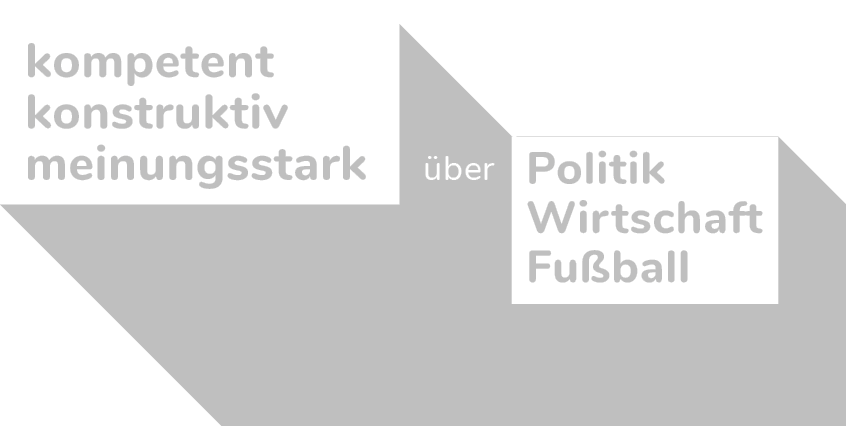Ein Anwalt slowenischer Kultur und ein Aufklärer in politischen Dingen
1913 im österreichischen Triest geboren als Sohn eines slowenischen Photographen, lernte Boris Pahor bereits als Kind ethnischen Hass kennen, die tödliche Krankheit des zwanzigsten Jahrhunderts.
Die Faschisten zündeten das Slowenische Kulturhaus an und verboten den Gebrauch der slowenischen Sprache. Die Familie verarmte, und das zehnjährige Kind verstummte beinahe, als es im ungewohnten Italienisch sprechen musste, „gleichsam mit einem falschen Gebiss im Mund“. Über kirchliche Schulen kam Pahor doch noch zu einem Literaturstudium in Padua, ehe ihn der italienische Staat als Soldaten nach Libyen verfrachtete.
Später arbeitete er als Dolmetscher in Oberitalien, und nach dem Zerfall Italiens im September 1943 schlug er sich nach Triest durch, wo er wenig später wegen eines politischen Artikels im Nachtkästchen verhaftet und für anderthalb Jahre in die Konzentrationslager Dachau, Natzweiler-Struthof, Dorä-Mittelbau und Bergen-Belsen verschleppt wurde.
Durch seine Sprachkenntnisse überlebte er als Dolmetscher und Krankenpfleger in der Dysenterie-Baracke. Sein Roman „Nekropolis“ (1967, deutsch 2001) gehört mit den Werken von Primo Levi, Robert Antelme und Imre Kertesz zu den bleibenden Zeugnissen des Unvorstellbaren. Nach der Befreiung 1945 konnte Pahor seine Tuberkulose in einem französischen Sanatorium ausheilen und durch die Liebe einer französischen Krankenschwester auch den Weg zurück in jenes Leben finden, das noch möglich war. Der
Roman „Kampf mit dem Frühling“ (1997) erzählt eindringlich von der schwankenden Bewusstseinslage, die erst allmählich zum Wiedererlangen des Interesses an der Welt führte.
Die Liebe scheiterte, und die Rückkehr nach Triest gestaltete sich ebenfalls schwierig, da diese Stadt noch kein Ort für pittoreske Krimis war, sondern an der Bruchlinie zwischen Ost und West lag und bis 1954 unter Verwaltung der Vereinten Nationen stand. Erst dann kam die Stadt mit einem schmalen Küstenstreifen definitiv an Italien, das Hinterland im Karst an Jugoslawien.
Im Kalten Krieg hatte ein Triestiner Slowene, der weder zum kommunistischen noch zum klerikalen Lager gehörte, einen schweren Stand. Es dauerte lange, ehe Pahor italienische und slowenische Literatur im italienischen Schuldienst unterrichten, eine Familie gründen und als Schriftsteller und Publizist leben konnte. Er blieb auf den Platz zwischen allen Stühlen abonniert, sei es als Anwalt slowenischer Kultur auf italienischem Boden, sei es als Aufklärer in politischen Dingen. Zusammen mit seinem Mentor, dem christlich-sozialen Intellektuellen und Widerstandskämpfer Edvard Kocbek, brachte er 1975 in seiner Zeitschrift „Zaliv“ erstmals die kommunistischen Mässenerschießungen von Kollaborateuren zur Sprache, deren Leichen in den Karsthöhlen („Foibe“) verschwanden. Pahor wurde für einige Zeit in Jugoslawien Persona non grata, und die niemals restlos aufgeklärte Sache wies auf die unbereinigten Gewalten voraus, die im Zerfall Jugoslawiens ausbrechen sollten.
Neben Unterricht und Redaktionstätigkeit entstanden Erzählungen und Romane, aber erst mit der Übersetzung von „Nekropolis“ ins Französische setzte 1990 internationale Anerkennung und schließlich später Ruhm ein. Sein Werk wurde in viele Sprachen übersetzt, auch ins Deutsche, die italienische Übersetzung von „Nekropolis“ wurde 2008 zu einem Bestseller, und man kann im Netz einen fulminanten Fernsehauftritt („II tempo chefa“) aufrufen, in dem Pahor Italienern Geschichte aus seiner Sicht erklärt. 2012 erschien bei Rizzoli seine Autobiographie „Figlio di nessuno“ (Niemands Sohn), die manche Schleier der Romane lüftet, doch nach einer Huldigung an seine 2009 verstorbene Frau Rada, der alle seine Bücher gewidmet sind, noch einmal zur doppelten Botschaft zurückkehrt, die Pahor als Konsequenz aus seinem Leben zieht: ungeschönte Aufklärung der Vergangenheit und freie Entfaltung kultureller Identität.
Der letzte Punkt, das Bestehen auf der nationalen Identität als Slowene, ist leicht misszuverstehen, doch Pahor hat stets das Sprachverbot als das Grundtrauma seines Lebens dargestellt, aus dem alles folgte. Genau betrachtet, ist ein Triestiner Slowene, der in Frankreich ins Leben zurückkehrte und den „eher die Schönheit als das Böse erschüttern“ kann, ein ziemlich idealer Europäer. Am 26. August wird Boris Pahor, 73 Tage vor Albert Camus, hundert Jahre alt.
von Thomas Poiss